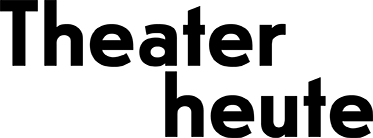Rückblick und Ausblick
Es war Januar 1970, als eine Gruppe junger Theaterkünstler:innen darüber nachdachte, im Privattheater der Schaubühne Berlin am Halleschen Ufer erstmals ein festes Ensemble zu gründen. Alle von ihnen hätten auch an einem Stadt- oder Staatstheater unterkommen können, denn sie waren keine Unbekannten, hatten bspw. in der «Tasso»-Inszenierung am Bremer Theater mitgewirkt, die in allen Feuilletons des Landes besprochen worden war.
Doch ihr Wille, andere Produktionsbedingungen auszuprobieren, war so groß, dass sie das Experiment eines Kollektivtheaters wagen wollten, um endlich die autoritären, hierarchischen Strukturen des Theaters hinter sich zu lassen. Als der Berliner Kultursenator einen Monat später per Handschlag für die kommenden zwei Jahre jeweils eine Fördersumme von 1,8 Millionen DM bewilligte, konnte das Projekt starten, das sich zu dem erfolgreichsten Theater Westdeutschland entwickeln sollte.
Am Anfang stand die Frage: Welche Probenbedingungen schaffen wir für uns? Die gemeinsamen Stück- und Besetzungsentscheidungen galt es zu verbinden mit der grundsätzlichen Forschungsaufgabe, wie sich das Verhältnis zwischen Ökonomie, Ideologie und Selbstbestimmung in den jeweiligen Stücken entschlüsselt lässt: Das Spiel sollte zu einer Erkenntnismethode werden.
Abgelehnt wurde ein Theater, das in jeder dramatischen Vorlage nur affirmativ die eigenen Verhältnisse hineinprojiziert, also längst Bekanntes immer nur reproduziert. Zugleich wollte sich das Ensemble aktiv an der Erarbeitung von Konzeptionen beteiligen, um nicht länger den Vorentscheidungen der Regie ausgeliefert zu sein. Die Spieler:innen sollten gleichberechtigt in Haupt- und Nebenrollen auftreten. Es war das Versprechen einer kollektiven Praxis in größtmöglicher Selbstbestimmung. Bezahlt wurde sie mit langen Diskussionen und Proben, die mit Reisen, Expertengesprächen, Schulungen und Recherchen verbunden waren.
Dieser Anspruch an die Theaterarbeit hat sich über die Jahre entzaubert, aber ein Rest steckt noch in den Köpfen unserer Theatergeneration. Und Probenbedingungen entscheiden nach wie vor über das Gelingen einer Inszenierung. Ein Spielensemble muss zunächst Vertrauen zum Regieteam finden, eine gemeinsame Spielweise kreieren, Neues riskieren und offen sein für den Anderen, damit am Ende etwas entsteht, was niemand sich hätte alleine ausdenken können. Dass Proben eine Magie entwickeln können, dass Probenprozesse nicht linear verlaufen, davon zehren Schauspieler:innen, die nicht der Routine ihres Berufs erliegen wollen. Viele von ihnen bereiten sich alleine auf den Probenbeginn vor (wenn es die Zeit zulässt), um nicht nur die Ideen der Regie zu erfüllen, sondern sich in künstlerischer Gemeinschaft einzubringen. Regieführende wiederum arbeiten gerne mit ihren Spieler:innen, wodurch sie in der knappen Probenzeit nicht erst Vertrauen erwerben müssen. Meist bevorzugen sie ein kleines Ensemble bei Stücken mit eigentlich großer Personage, um auf mögliche Erwartungen vieler Spielenden nicht eingehen zu müssen.
Weniger wäre mehr
Dass man sich diesen Freiraum des Entwerfens und Verwerfens in den eng geführten Dispositionen unserer Spielpläne abringen muss, gehört zum Alltag einer Branche, die ihren Erfolg auf Auslastungszahlen und Einnahmen bauen muss. Die Lage wird schwieriger, weil wir endlich den NV-Solovertrag an das europäische Arbeitsrecht angepasst haben: mehr Ruhezeiten, zwei Monate vorher angekündigte freie Tage, probenfreier Samstag etc. Bei zeitgleicher Kürzung der Subventionen wird der Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und kaufmännischem Realitätssinn immer größer: Bühnenproben werden Voraufführungen, die man verkaufen kann, um Einnahmen zu generieren; Abendproben mit einem Ensemble sind kaum noch möglich, weil Vorstellungen gespielt werden müssen; Vormittagsproben beschränken sich oft auf Zeiten bis 13 Uhr, da vor dem Maskentermin fünf Stunden Ruhezeit einzuhalten sind ebenso wie die festgelegten freien Tage.
Zu kompensieren wäre das alles mit einem längeren Probenzeitraum, doch dieser ist mit neuen Kosten verbunden: Ein Regieteam wäre durch längere Unterkünfte und Reisen schon teurer, mehr Probenzeit hieße zugleich weniger Produktionen, weniger Produktionen wie -derum weniger Auslastung und Ein -nahmen – die Erfolgsrechnung ginge womöglich nicht mehr auf. Seit vielen Jahren haben die Theater ihre Produktionszahl erhöht und damit trotz Zuschauerschwund mehr Eintrittskarten verkauft und zugleich die Ensembles um knapp ein Drittel verkleinert. So hielt man dem ökonomischen Druck stand. Soll jetzt die Probenzeit beschnitten werden?
Wir werden in der kommenden Zeit den Mut brauchen, weniger zu produzieren, um Proben zu garantieren, die eine Voraussetzung für außergewöhnliche Aufführungen sind. Dafür muss Kulturpolitik einmal mehr verstehen: Wir verkaufen nicht nur fertige Produktionen. Als Institution, die Kunst ermöglicht, schaffen wir Raum und Zeit, um künstlerische Prozesse entstehen zu lassen, deren Ergebnis immer ein Wagnis bleibt. Oder wollen wir am Ende gar unsere Ansprüche runterschrauben und uns von Effizienz und Ökonomie die Produktionsbedingungen diktieren lassen?
MARION TIEDTKE ist Dramaturgin und Professorin für Schauspiel. Sie leitet den Studiengang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) in Frankfurt am Main.

Theater heute Januar 2026
Rubrik: Magazin, Seite 73
von Marion Tiedtke
Während manche Klassiker wegen ihrer Inkompatibilität mit dem aktuellen Wertekanon beinahe unbemerkt von den Spielplänen verschwinden, erleben andere trotz oder gerade wegen scharfkantiger Ecken des Anstoßes in regelmäßigen Zyklen ein Revival wie derzeit auch Heinrich von Kleists «Der zerbrochene Krug». War man schon auf einen weiteren gegenwartsgesättigten MeToo-Kommentar im Kleistschen...
Von der Eisernen Lady Margaret Thatcher ist der Ausspruch überliefert: «So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Männer und Frauen.» Der Slogan markiert nach landläufiger Meinung den Auftakt für den Neoliberalismus in Europa, der bald schon ein Heer an versprengten Ich-AGs über die Märkte schwemmte und zivilgesellschaftliche Institutionen ins freie Spiel der...
Es ist nicht immer der große Wow-Effekt, der am längsten in Erinnerung bleibt. Wobei auch der seinen Reiz haben kann: Wenn sich in «Ocean Cage» von Tianzhuo Chen zur Eröffnung des Münchner Spielart Festivals 2025 alles um Wind und Walfang dreht und nach einer Stunde im immersiven Sturmgebraus – zwischen historischen Dokumentaraufnahmen der in -digenen Jagd auf Holzbooten, spirituellem...