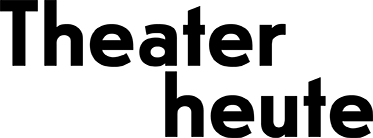Planungsversagen
Es entbehrt nicht der Ironie, dass Frank Castorfs Nachfolger Chris Dercon und seine Programmdirektorin Marietta Piekenbrock nach nur sieben Monaten an so etwas Banalem wie miesem Management gescheitert sind.
Zweieinhalb Jahre lang hat sich schließlich die Berliner Theater- und Kunstszene die Köpfe bis zum Rauchaufstieg heißdiskutiert über der Frage, ob Castorf alternativlos forever sei oder die Volksbühne nach 25 Jahren nicht doch mal ein neues Leitungsgesicht verdient habe, ob Dercon als neoliberaler Profiteur des symbolischen Volksbühnenkapitals oder als progressiver, weil international und interdisziplinär vernetzter Theatererneurer einzuschätzen sei, ob die Volksbühne künftig ein festes Schauspielensemble brauche oder Theater nicht ohnehin auch anders denkbar sei, etc. Von der verblüffenden Implosion der Dercon-Intendanz aus betrachtet, werden manche dieser ideologischen Streitpunkte sekundär.
Vor seinem Berliner Engagement war Chris Dercon immerhin – und das hat ihn in den Augen des damaligen Kulturstaatssekretärs Tim Renner ja auch zweifellos für den Volksbühnenjob qualifiziert – acht Jahre Direktor am Münchner Haus der Kunst und von 2011 bis 2016 Direktor der Londoner Tate Modern. Jeweils durchaus erfolgreich; von schlechten Zahlen oder Mismanagement war dort nie die Rede. Seine Managementkompetenz hätten vor dem Spielzeitauftakt wohl weder Freund noch Feind Dercon abgesprochen, den ein Wirtschaftsgipfel der «Süddeutschen Zeitung» sogar Ende letzten Jahres als Experten auf ein Panel mit dem schönen Titel «Anders führen − was können Manager von Führungskräften aus anderen Bereichen lernen» einlud.
Schon als Kunstdirektor hatte Dercon durchaus sperrigere Künstler wie Christoph Schlingensief oder Wolfgang Tilmanns programmiert. In der kurzen ersten Spielzeit an der Berliner Volksbühne und mit Hilfe seiner Programmdirektorin Marietta Piekenbrock steigerte sich das sogar noch: Ihr Spielplan war alles andere als anbiedernd, nämlich nischenhaft, sperrig, oft überambitioniert. Schon bei der ersten Pressekonferenz fiel auf, dass kaum Eigenproduktionen vorgesehen waren, dafür zahlreiche Gastspiele und Konzeptadaptionen (wie von Boris Charmatz und Jérôme Bel). Und ja, es schien primär weder vom Schauspieler noch vom Repertoire her gedacht zu sein.
Unberaten und beratungsresistent
Für beides – den Mangel an Schauspieler*innen wie Eigenproduktionen – konnte man damals noch die Abwehrhaltung der alten Belegschaft verantwortlich machen, die Dercon & Team anfangs nur mit Anwaltsschreiben ins Haus und auch sonst wenig unversucht ließen, um den Belgier in der Szene schlecht zu reden. Doch spätestens mit der Schlüsselübergabe Anfang Juli sowie mit dem absehbaren finanziellen Scheitern der Tempelhofplanungen hätte ein Umschwenken und Neuplanen stattfinden müssen. Allein, es passierte nichts. Und das war gravierender als der mäßige Erfolg der drei Eigenproduktionen: Während Mohammad al-Attars charmanter, aber auch etwa dünner Dokumentartheaterabend «Iphigenie» mit geflüchteten jungen Frauen im riesigen Tempelhofer Hangar 5 zusätzlich verzwergt wurde, waren Susanne Kennedys hyperkünstliche «Women in Trouble» und Albert Serras Sänftenballett «Liberté» die einzigen Theaterproduktionen, die überhaupt die große Bühne und damit (wenigstens zeitweilig) den Zuschauerraum füllen konnten.
Hätte niemand den Quereinsteigern mal stecken können, dass man mit einer Festivalkalkulation kein Stadttheater mit 200 Spieltagen im Jahr betreiben kann? Oder dass man am Kulturstandort Berlin keinen Cent auf Sponsoring zu wetten braucht? Tim Renner gab im Nachklapp des Rücktritts zu Protokoll, es sei ein Fehler gewesen, nach René Polleschs Absage des für ihn vorgesehenen Amtes als Schauspielleiter das Konzept nicht nochmal zu überprüfen. Umgekehrt ergab eine Recherche von RBB, NDR und SZ, dass Marietta Piekenbrock ihn ausdrücklich auf die «delikate» Frage der Strukturveränderung in Sachen Ensemble hingewiesen habe, worauf Renner erwidert habe, das «stehe für ihn nicht im Vordergrund».
Fest steht, dass hier eine mögliche und grundlegende Strukturveränderung vollkommen sich selbst und dem Zufall überlassen und deshalb auch nicht im Geringsten – und hier wäre es durchaus Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller und eines Kulturstaatssekretärs gewesen – vermittelt wurde. Auf der anderen Seite spricht einiges dafür, dass Dercon und Piekenbrock weitgehend beratungsresistent blieben, sich etwa bewusst und ausdrücklich gegen eine Person mit Stadttheatererfahrung im Kuratorenteam entschieden.
Dass der amtierende Kultursenator Klaus Lederer jetzt ziemlich schnell – und anscheinend auf Chris Dercons Initiative hin – reinen Tisch gemacht und den bereits Ende März als neuen Volksbühnengeschäftsführer bestellten Stuttgarter Geschäftsführer Klaus Dörr auch zum kommissarischen Leiter ernannt hat, hat den Vorteil, dass man nun gründlich über eine Nachfolge und die mit ihr verbundenen Fragen nachdenken kann. Denn gerade in einer Kulturstadt wie Berlin mit ihren fünf Sprechtheaterensembles sollte unbedingt und transparent über die schon seit geraumer Zeit in der Szene diskutierten Möglichkeiten neuer Theaterstrukturen, Kollektivleitungen, über ein auch in seinen künstlerischen Kompetenzen diverses Ensemble nachgedacht werden. Das ist eine knifflige Aufgabe, die weder ein Theater wie die Münchner Kammerspiele in zweieinhalb Spielzeiten noch ein weltläufiger Kunstpromi auf Anhieb lösen können.

Theater heute Mai 2018
Rubrik: Foyer, Seite 1
von Eva Behrendt
Früher war Liebe bei Peter Turrini eine Kampfansage. Auf einer Müllhalde («Rozznjogd»), im Kaufhaus («Josef und Maria») oder in der Berghütte («Alpenglühen») kamen die seltsamsten Paare zusammen, und immer stellten sie die kleinstmögliche Form von Bandenbildung dar: zwei gegen den Rest der Welt. Das Rentnerpaar aus seinem neuen Stück «Fremdenzimmer» hat seine besten Jahre lange hinter...
Im Kleinsten steckt das Allergrößte, das wussten schon die Mystiker. Also zum Beispiel die Unendlichkeit in der Zahl Null. Oder, anderes Beispiel, das größtmögliche Desaster im winzigen Einsilber «Krieg». Der betitelt eine epochale Suada, die Rainald Goetz dem Theater 1986 vor den Latz geknallt hat (um es gleich mal in der richtigen Tonlage auszudrücken). Krieg also. Und dann gute...
Wenn in der zweiten Maiwoche beim Berliner Theatertreffen Karin Henkels Zürcher Inszenierung «BEUTE FRAUEN KRIEG» zu sehen sein wird, eine Euripides-Kompilation der «Troerinnen» von John von Düffel und «Iphigenie in Aulis» von Soeren Voima, die die Geschichte der Frau als instrumentalisiertes Opfer in von Männern betriebenen Kriegen erzählt, dann könnte ein anschließender Besuch ihrer...